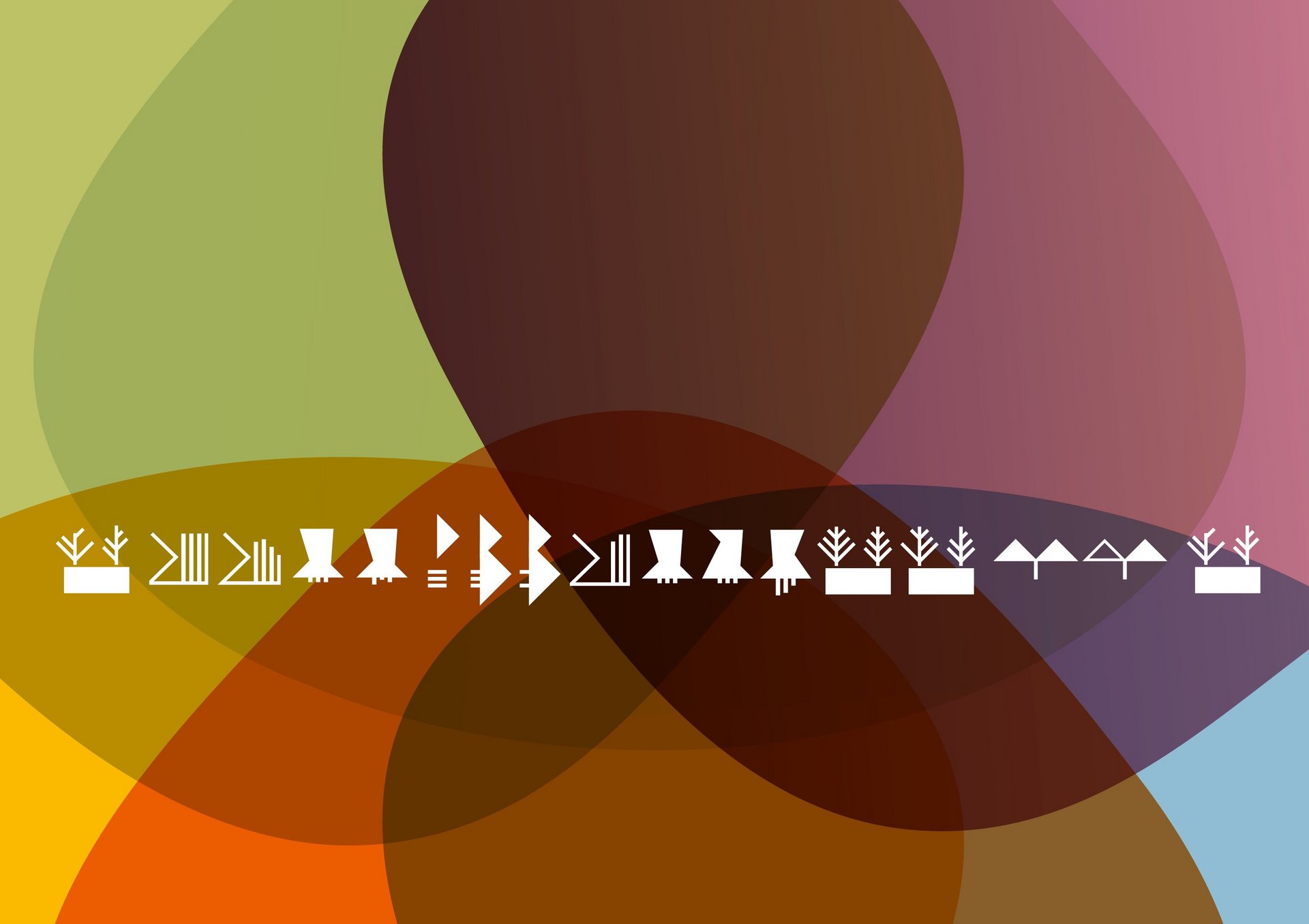
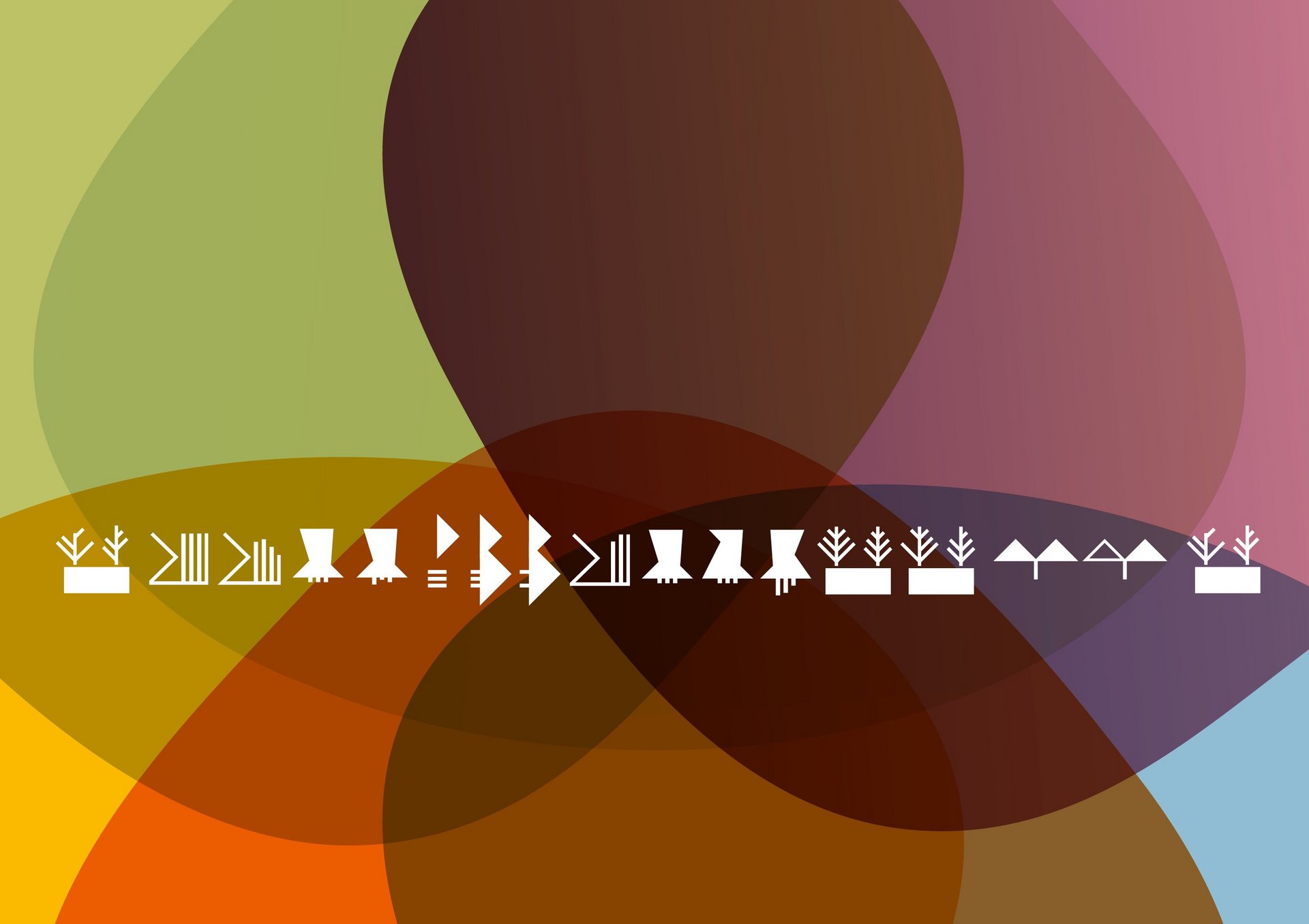
Diverse Institute und Fachbereiche der Universität St.Gallen forschen und lehren zu Gender & Diversity. Sie engagieren sich für Inklusion innerhalb und ausserhalb der Universität. Das Gender Portal macht diese Tätigkeiten sichtbar, ermöglicht die Vernetzung und verweist auf aktuelle themenspezifische Veranstaltungen an der HSG.
Der Fachbereich Gender & Diversity koordiniert das Gender Portal. Hinweise zu weiteren Veranstaltungen und Lehrtätigkeiten werden gerne unter gender@unisg.ch entgegengenommen.